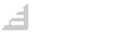Tradition trifft auf moderne Techniken
Bewässerung von Bäumen: oldschool oder lieber zukunftsorientiert?
von: M. Eng. Lukas J. Barczyk, Dipl.-Ing. Ramon SteinkopfWarum lohnt es sich, einen Beitrag über die Bewässerung von Bäumen zu schreiben? Weil uns auch hier die großen Themen der Zeit (Fachkräftemangel, Inflation, Klimawandel) dazu zwingen, Gewohntes zu hinterfragen und neue Wege zu gehen.
Aber fangen wir ganz vorne an: "Es hat doch gerade erst geregnet. Warum werden denn jetzt die Bäume gewässert?" Dabei ist jetzt genau der richtige…