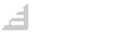Neue Impulse für die städtische Baumpolitik
Brauchen wir noch ganz andere Zukunftsbäume? (Teil 2)
von: Jonas ReifDie Lebensbedingungen für Bäume waren bereits vor den zunehmend spürbaren Auswirkungen des Klimawandels in Städten oft erschwert. Teil 2 meines Beitrages beschäftigt sich mit neuen Ansätzen zur Erhöhung der Vielfalt. Zugleich soll eine Idee vorgestellt werden, die Baumpflanzungen an Problemstandorten und damit sogar eine signifikante Anzahl-Steigerung in Innenstädten…