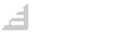Teil 1
Brauchen wir ganz andere Zukunftsbäume?
von: Jonas ReifDie Lebensbedingungen für Bäume waren bereits vor den zunehmend spürbaren Auswirkungen des Klimawandels in Städten oft erschwert. Die daraus abzuleitenden Konsequenzen sind allgemein unstrittig und werden unter anderem im "Weißbuch Stadtgrün" dargelegt. In der Umsetzungsebene sollten jedoch Alternativen und neue Strategien diskutiert werden. Dieser Artikel soll dazu einen…