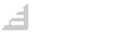Wandgebundene Fassadenbegrünung
Grüne Wände für lebendige Städte
von: Dr. Leoni MackStädtische Grünflächen fallen immer mehr der zunehmenden Verdichtung und Versiegelung zum Opfer. Die Folgen waren in den letzten Jahren deutlich zu sehen: Die Städte heizen sich auf und heimische Tierarten werden rar. Eine Möglichkeit, trotz Flächendruck neues Grün zu schaffen, ist die wandgebundene Fassadenbegrünung, die bei entsprechender Gestaltung auch einen wertvollen…