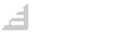Inklusive Spielräume: Fähig- und Fertigkeiten im Fokus
von: Dipl.-Ing. (FH, MPA) Peter Schraml
Balancieren auf Balken, Slacklines oder über eine Hängebrücke? Die Wege dorthin sind begeh- und berollbar und die Zugänge dorthin tast- wie sichtbar. Ein Kind sitzt in der Sandfläche, an anderes mit dem "Rolli" bequem an einem Sandtisch und gibt das Wasser frei - beide bauen gemeinsam nach Herzenslust Burgen. Jeder findet etwas Passendes zum Spielen und das idealer Weise räumlich so gestaltet, dass ein zusammen Spielen, ein gemeinschaftliches Miteinander entsteht.
So, unter anderem, stellt sich der "Arbeitskreis Inklusion des Normungsausschusses NA 112-07-01 AA Spielplatzgeräte" (AK Inklusion) inklusive Spielräume vor. Orte, die allen Kindern Spielmöglichkeiten bieten, wo jedoch nicht jedes Spielgerät von jedem Kind nutzbar sein muss. Um das zu erreichen, arbeitet der AK Inklusion seit 2016 an einer Matrix, die entsprechende Grundanforderungen definiert, die - wie bei jeder kreativen Arbeit - auf vielfältige und sehr unterschiedliche Weise umgesetzt werden können. Dabei wendet sie den Fokus weg von spezifischen Behinderungen hin zu Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Grundsätzlich folgt die Planung eines barrierefreien Spielplatzes denselben prinzipiellen Kriterien, wie die eines nicht barrierefreien. Denn: Unbeschwerte Spielerlebnisse sind für die kindliche Entwicklung unverzichtbar. Kinder suchen Herausforderungen und ein bisschen Nervenkitzel - in jeder Entwicklungsstufe und entsprechend der individuellen Fähig- oder Fertigkeiten. Fast alle Kinder möchten klettern, schaukeln, rutschen, wippen und gestalten. Dennoch stellt die Forderung nach inklusiven Spielräumen viele Kommunen, Planer und Landschaftsarchitekten vor Probleme. Häufig wird barrierefrei als "rollstuhlgerecht" interpretiert und umgesetzt - und zwar unabhängig davon, ob es im Einzugsbereich eine relevante Zahl an Rollstuhlfahrern gibt.
NL-Stellenmarkt


Inklusion berdeutet: Dabei sein
Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch dabei sein und nach seinen eigenen Fähig- und Fertigkeiten mitmachen kann. Eine allgemeingültige Definition von Barrierefreiheit für Spielplätze gibt es bislang nicht, wohl aber verschiedene Gesetze, Konventionen und Normen: das Behinderten- Gleichstellungsgesetz (BGG), die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009, die DIN 33942 "Barrierefreie Spielplatzgeräte" sowie die DIN 18034 "Spielplätze und Freiräume zum Spielen".
Das BGG definiert "Barrierefreiheit" in § 4: Anlagen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände gelten demnach als barrierefrei, wenn sie in allgemein üblicher Weise ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe nutzbar sind.
Auf Spielplätze übertragen, entsteht damit jedoch eine unmögliche Forderung: Demnach müssten Kinder jeden Alters und unabhängig von jeglichen motorischen oder kognitiven Einschränkungen jedes Spielgerät nutzen können.
Spielgeräte werden jedoch bewusst mit "Zugangsfiltern" geplant und gebaut. Ein Kind soll und darf auf einem Spielplatz nur dorthin gelangen, wo es die Gefahren selbstständig wahrnehmen und beurteilen kann. Das hängt von Alter, Entwicklungsstand und kognitiven sowie motorischen Fähigkeiten ab. Erreichen Krabbelkinder die eine Ebene eines Spielplatzgerätes beispielsweise über eine Rampe, können größere Kinder über Leitern oder ähnliches eine andere Ebene erklettern. Dies verhindert, dass Kinder ein für sie noch nicht geeignetes Gerät nutzen.

Zwei-Wege-System und Zwei-Sinne-Prinzip
Der AK Inklusion hat daher zunächst festgelegt, dass inklusive Spielräume Angebote machen, die jeder entsprechend seinen Möglichkeiten nutzen kann - unabhängig von einer Behinderung. Ein wichtiger Aspekt sind daher Spielangebote, die unterschiedliche Sinne und Fähigkeiten ansprechen. Pflanzen für Optik, Haptik und den Geruchssinn, der Einsatz verschiedener Materialien ermöglicht unterschiedliche taktile sowie optische Erlebnisse und Angebote, mit denen Geräusche erzeugt werden können, bringen die akustische Welt mit ein. Je abwechslungsreicher hier die Auswahl, desto mehr bindet sie alle Kinder mit ihren unterschiedlichen individuellen Fähigkeiten ein.
Eine bedeutende Rolle kommt außerdem der Anordnung der Spielplatzgeräte zu: Ermöglicht sie vielfältige Spielabläufe? Bietet sie die Möglichkeit zu Entdeckungen? Kann das Geschehen zunächst aus sicherer Entfernung beobachtet werden? Gibt es Rückzugsorte?
Gute Ergebnisse erzielt, wer Spielgeräte und Spielplätze nicht isoliert betrachtet, sondern das Umfeld im Blick behält. Die Erreichbarkeit des Spielplatzes selbst (entsprechende Regelungen enthält die DIN 18034), sowie der einzelnen Stationen auf dem Spielplatz, sind ebenfalls wesentlich. Hier setzt die Matrix auf das "Zwei-Wege-System" und "Zwei-Sinne-Prinzip". Nutzenden eröffnen diese beiden Kategorien zum einen die Wahlmöglichkeit (Kann ein Zugang erkannt werden, weil er beispielsweise nicht "nur" sichtbar, sondern auch tastbar ist?) und zum anderen den Zugang. So kann auch eine Treppe durchaus barrierefrei sein. Als einzige Zugangsmöglichkeit grenzt sie manche Menschen jedoch aus.
Eine Matrix für Vielfalt
Die von dem AK Inklusion entwickelte Matrix folgt dem Grundsatz: Dabei sein und nicht außen vor. Sie benennt Kriterien, an denen sich Planer und Betreiber orientieren können und funktioniert so als Gedächtnisstütze: Habe ich an Kriterien gedacht, die einen Spielplatz inklusiv machen? Eine Perspektive, die das auf Spielplätzen anzutreffende Spektrum an Spiel- und Erlebnisangeboten erweitern und sich von den bislang vorherrschenden unterscheiden wird. Erfüllt ein Spielplatz durch Geräte, räumliche Anordnung, Wege und Plätze etc. eine bestimmte Anzahl der in der Matrix aufgestellten Kriterien, erhält er das Prädikat "Inklusiver Spielraum". Dieses System ist sehr flexibel, da es nicht den einen barrierefreien Musterspielplatz definiert, der dann als Standard vielfach kopiert wird, sondern viele verschiedene Möglichkeiten eröffnet. Zudem lässt sich das Bewertungssystem auf bestehende Spielplätze anwenden.

Fazit
Spielplätze die nach den vorgenannten Kriterien bestimmte Schwerpunkte und Schwierigkeitsstufen berücksichtigen sind flexibel. Zwar wird nicht jedes Kind jedes Angebot nutzen können, aber jedes Kind findet auf jedem dieser Spielplätze etwas, das es kann und ihm Spaß macht. Abstufungen bieten den Ansporn, sich schrittweise an die nächsthöheren Schwierigkeitsstufen heranzuwagen.
- Themen Newsletter Spielgeräte bestellen
- Themen Newsletter Spielplatzbau bestellen
- Themen Newsletter Spielplätze bestellen
- Themen Newsletter Spielräume in der Stadt bestellen
- Themen Newsletter Barrierefreiheit bestellen
- Themen Newsletter Inklusion bestellen
- Unternehmens Presseverteiler Massstab Mensch bestellen