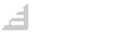Klimawirksame Wiesen für den Siedlungsbereich
Biodiverse Oasen
von: Dipl. -Ing. Andreas AdelsbergerStädtische und kommunale Freiräume spielen beim Schutz der biologischen Vielfalt und bei der Klimamäßigung eine wichtige Rolle, da Parks, Friedhöfe, Straßenbegleit- und Abstandsgrün sowie Freiräume an Stadträndern beachtliche Flächenressourcen darstellen. Mit arten- und strukturreichen Wiesenflächen statt regelmäßig kurzgeschorenem "Landschaftsrasen" können entsprechende…