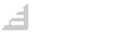Außenbeläge
Nachhaltige Bodenbeläge aus Naturwerkstein
von: Dipl.-Ing. Reiner KrugAußenbeläge aus Naturwerkstein liefern einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, da sie einen geringen Energiebedarf sowie geringe CO2-Emissionen aufweisen, die Versickerung von Regenwasser ermöglichen, die ungewollte Erwärmung der Innenstädte vermeiden und extrem lange Nutzungsdauern aufweisen.
Waren in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend wirtschaftliche Kriterien…