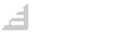GaLaBau und Recht: Bau-Fachanwalt Rainer Schilling empfiehlt
Immer wieder Streit wegen Vertragsstrafen
von: Rainer SchillingIn letzter Zeit habe ich in meiner Kanzlei wieder häufiger mit Streitigkeiten zu tun, bei denen die Auftraggeberseite vom Unternehmer eine Vertragsstrafe beansprucht. Auftraggeber rechnen zum Beispiel in einem Rechtsstreit, in dem der Unternehmer eine Vergütungsforderung aus seiner Schlussrechnung geltend macht, wegen verspäteter Fertigstellung der Arbeiten mit einer…