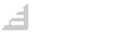Umweltgerechtigkeit in der Klimaanpassung
"Grüne Kühlung" ist in Großstädten sozial ungleich verteilt
Eine europaweite Studie unter Leitung der Technischen Universität Berlin, an der auch die Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien beteiligt war, zeigt, dass Menschen mit niedrigem Einkommen in innerstädtischen Quartieren am wenigsten vom Kühlungseffekt durch urbanes Grün profitieren. Das fordert die Umweltgerechtigkeit heraus, denn Hitzestress im Sommer ist die häufigste…